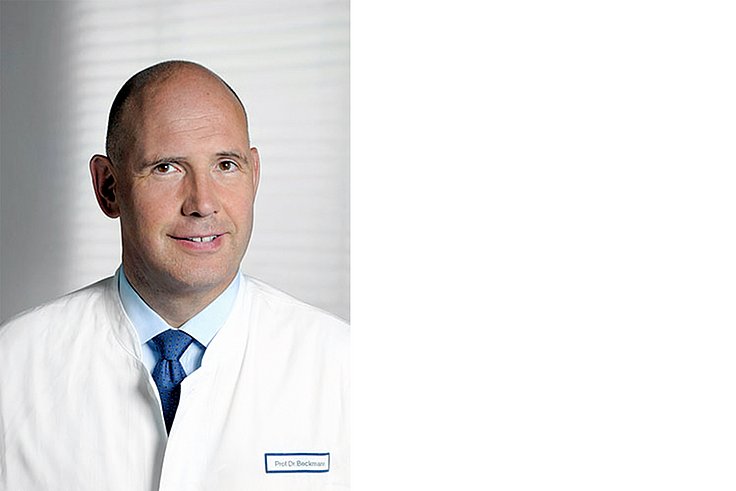
Seit 2001
Matthias W. Beckmann (*1960)

1984 -- 2001
Norbert Lang (*1936 -- †2015)
Spezialisierung über die ganze Breite des Fachgebietes
Norbert Lang wurde am 6. März 1936 in Pirmasens geboren. Nach dem Abitur 1953 am Humanistischen Gymnasium in Landshut studierte er Medizin in München und an der Freien Universität (FU) Berlin, wo er 1959 das Staatsexamen ablegte und 1960 promoviert wurde. Die damals vorgeschriebene Medizinalassistentenzeit leistete Lang bis zum Dezember 1961 zu je einem Jahr in West-Berlin und in den USA ab (Orange, New Jersey). Von 1962 bis 1964 arbeitete er als Postdoctoral Fellow am Physiologisch-Chemischen Institut der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) bei dem Biochemiker Peter Karlson, einem Schüler des Nobelpreisträgers Adolf Butenandt, über den Wirkungsmechanismus von Steroidhormonen.
Seine Facharztausbildung absolvierte Lang von 1964 bis 1968 in München an der I. Universitätsfrauenklinik (UFK) bei Werner Bickenbach, anschließend ging er als Oberarzt zu Ernst Jürgen Plotz an die UFK Bonn, wo er sich 1969 mit einer Arbeit zum Wirkungsmechanismus von Cortisol an der Leberzelle habilitierte. 1973 erfolgte die Ernennung zum außerplanmäßigen Professor und zum Leitenden Oberarzt, 1978 zum C3-Professor mit dem Schwerpunkt Pathophysiologie der Reproduktion. Als Lang 1984 nahezu zeitgleich Rufe an die Universtäten Homburg/Saar und Erlangen erhielt, hatte er die Bonner UFK nach dem Ausscheiden seines Lehrers Plotz zwei Jahre lang kommissarisch geleitet.
Dem Ruf nach Erlangen folgend trat Lang die Nachfolge von Karl Günther Ober an, der die Klinik zu einem Zentrum der operativen Gynäkologie ausgebaut und darüber hinaus jene reproduktionsmedizinische Arbeitsgruppe etabliert hatte, die 1982 als erste in Deutschland die Geburt eines Kindes nach In-vitro-Fertilisation (IVF) feiern konnte. Lang setzte die damit eingeleitete Spezialisierung der Klinik über die Breite des Fachgebietes konsequent fort, indem er das Spektrum des reproduktionsmedizinischen Schwerpunktes um die gynäkologische Endokrinologie erweiterte und einen zusätzlichen Schwerpunkt für Ultraschall und Perinatalmedizin einrichtete. So waren in Erlangen bereits zu Beginn der 1990er Jahre jene drei Säulen des Faches errichtet, die noch heute von den meisten Fachvertretern als unverzichtbare Basis für die Erfüllung der Aufgaben in Forschung, Lehre und Krankenversorgung betrachtet werden.
Das erforderliche Rüstzeug, aber auch den Blick für das Entwicklungspotenzial der genannten Schwerpunkte, hatte sich Lang im Verlauf seiner sehr vielseitigen Ausbildung sowie in der eigenen klinischen und wissenschaftlichen Tätigkeit erarbeitet. Sowohl Bickenbach in München als auch Plotz in Bonn galten als ausgewiesene Forscher auf dem Gebiet der Endokrinologie. In Bonn war Lang auch in der Perinatalmedizin und in der operativen Gynäkologie wissenschaftlich aktiv: Zusammen mit dem Ultraschall-Pionier Manfred Hansmann publizierte er erstmals über eine ultraschallgesteuerte Bluttransfusion bei einem ungeborenen Kind mit einer Rhesusunverträglichkeit. Außerdem entwickelte Lang eine operative Technik zur Behandlung von Frauen, die ohne eine Scheide geboren wurden (Meshgraft-Neovagina).
Schwerpunkte der wissenschaftlichen Arbeit nach dem in Erlangen etablierten Konzept waren in der gynäkologischen Onkologie Forschungen zur risikoadaptierten Therapie des Mammakarzinoms, die damals noch auf eigenen pathologischen Untersuchungen basierten. Fragen zur Pathogenese und Therapie des Ovarialkarzinoms wurden klinisch-biochemisch, molekulargenetisch sowie tierexperimentell bearbeitet. In der Endokrinologie und Reproduktionsmedizin lagen Schwerpunkte der Forschung bei der Pathophysiologie und Therapie der Ovarialinsuffizienz sowie in der Kryokonservierung von Gameten. Die Arbeiten in der Perinatalmedizin konzentrierten sich auf den Wert der (Doppler)sonografie zur Diagnostik von Fehlbildungen und fetoplazentaren Perfusionsstörungen sowie auf Untersuchungen zur Pathophysiologie und Therapie der Spätgestosen.
Während seiner Erlanger Tätigkeit war Lang von 1988 bis 1990 auch Ärztlicher Direktor des Universitätsklinikums. Seine vielen Schüler, darunter zwölf Habilitierte, schätzen den konsequenten Stil, den er in Diagnostik und Therapie pflegte und weitervermittelte. Nach seiner Emeritierung 2001 erkor Lang Erlangen auch zu seinem Altersruhesitz. Er starb am 5. August 2015 nach langer Krankheit.
1983/84
Herwig Egger (*1943)

1962 -- 1983
Karl Günther Ober (*1915 -- †1999)
Erlangen wird ein Zentrum der operativen Gynäkologie
Karl Günther Ober wurde am 24. August 1915 in Berlin geboren, besuchte dort die Schule und studierte Medizin. Einer Empfehlung von Ferdinand Sauerbruch (1875 -- 1951) folgend bildete sich der junge Arzt mit dem ursprünglichen Berufswunsch Chirurgie zunächst als Pathologe weiter. Im Sektionssaal zog sich Ober 1942 jedoch eine Tuberkulose zu, die ihm eine jahrelange Pause in der Berufsausübung auferlegte. Wieder genesen wandte er sich der Frauenheilkunde zu, wurde 1948 Assistent des berühmten Gynäkologen Carl Kaufmann (1900 -- 1980) in Marburg und Köln, habilitierte sich 1954 und nahm 1962 einen Ruf auf den Erlanger Lehrstuhl für Geburtshilfe und Gynäkologie an. Ober blieb der mittelfränkischen Universität ungeachtet späterer Rufe nach Bonn (1965) und Köln (1969) treu. Er wählte Erlangen auch als Alterssitz und starb hier am 27. Februar 1999.
Schwerpunkte der wissenschaftlichen Arbeit Obers finden sich in der gynäkologischen Endokrinologie und vor allem in der Onkologie. So trug er entscheidend dazu bei, eine wirksame hormonelle Therapie der dysfunktionellen Uterusblutungen zu etablieren, die zuvor häufig nur durch chirurgische Intervention beherrschbar waren. Zusammen mit Kaufmann und dem Bonner Pathologen Herwig Hamperl (1899 -- 1976) führte Ober außerdem an speziell hergestellten histologischen Großflächenschnitten der Cervix uteri und ihrer Nachbargewebe umfangreiche Untersuchungen durch. Dadurch konnte der morphologischen Formenwandel des Gebärmutterhalses in den verschiedenen Lebensabschnitten der Frau erstmals systematisch beschrieben werden. Ferner ließen sich neue Einsichten zur Pathophysiologie der Frühformen des Zervixkarzinoms gewinnen, die in Empfehlungen zu einer weniger radikalen, stadienadaptierten Behandlung mündeten.
Ober galt als ungewöhnlich begabter Operateur. Unter seiner Leitung erwarb sich die zuvor über Jahrzehnte relativ einseitig radiologisch ausgerichtete Erlanger Klinik rasch eine Spitzenstellung im Kreis der operativen und onkologischen Zentren der deutschen Gynäkologie. Er förderte aber auch schon sehr früh Untersuchungen zur In-vitro-Fertilisation (IVF). Sie führten 1982 in Erlangen zur Geburt des ersten deutschen "Retortenbabys", die von einem gewaltigen Medienspektakel begleitet war.

1950 -- 1962
Rudolf Dyroff (*1893 -- †1966)
In der Tradition von Seitz und Wintz
Rudolf Dyroff wurde am 14. April 1893 in Ingolstadt geboren. Nach dem Besuch des Humanistischen Gymnasiums und dem Medizinstudium absolvierte er zunächst eine Ausbildung bei dem berühmten Pathologen Ludwig Aschoff mit dem Schwerpunkt gynäkologische Histologie. Zu seinen klinischen Lehrern in der Frauenheilkunde zählte neben Ludwig Seitz (1872 -- 1961) und Hermann Wintz (1887 -- 1947) auch der Münchner Ordinarius Albert Döderlein (1860 -- 1941). Dyroff habilitierte sich 1927 in Erlangen bei Wintz für das Fach Gynäkologie, Geburtshilfe und Röntgenologie. 1933 wurde er zum außerordentlichen Professor ernannt. 1950 berief man ihn nach kommissarischer Klinikleitung schließlich zum Nachfolger von Wintz im Ordinariat. Dyroff starb am 17. Juni 1966.
Rudolf Dyroff hat die radiologisch orientierte Tradition seiner Erlanger Lehrer mitbegründet und später fortgesetzt. Neben der Krebstherapie setzte er sich intensiv mit der Histologie bestrahlter Gewebe auseinander. Außerdem widmete er sich der Einführung und Verbesserung röntgenologischer Methoden in der Diagnostik. Dyroff arbeitete hier beispielsweise über die Beckenmessung, Röntgenstereometrie und Tubendarstellung. Von seinen Mitarbeitern ließ er strahlenbiologische Probleme untersuchen. Es ging ihm darum, die Bestrahlungspläne für onkologische Patienten weitgehend zu individualisieren, um unter größtmöglicher Schonung gesunden Gewebes optimale Behandlungserfolge zu erzielen.
Neben seinem strahlentherapeutischen Engagement war Dyroff zusätzlich chirurgisch orientiert. Er galt als hervorragender Operateur. Während der Zeit des Nationalsozialismus setzte er diese Fähigkeiten allerdings dazu ein, sich an den Zwangssterilisationen zu beteiligen, die auch in der Erlanger Frauenklinik durchgeführt wurden. Als Oberarzt von Wintz hatte er außerdem Abtreibungen an Zwangsarbeiterinnen mit zu verantworten. Obwohl Dyroff deswegen nach dem Krieg zunächst aus dem Hochschuldienst entlassen worden war, erhielt er 1950 doch den Ruf als Nachfolger seines Lehrers Wintz. Eine sehr emotional geführte öffentliche Diskussion, die sogar den Bayerischen Landtag beschäftigte, änderte daran nichts.
1946 -- 1947, 1947 -- 1949
Walter Rech (*1896 -- †1975), zweimalige Entlassung durch die Militärregierung
1945 (Juni/August)
Rudolf Dyroff (*1893 -- †1966), Entlassung durch die Militärregierung
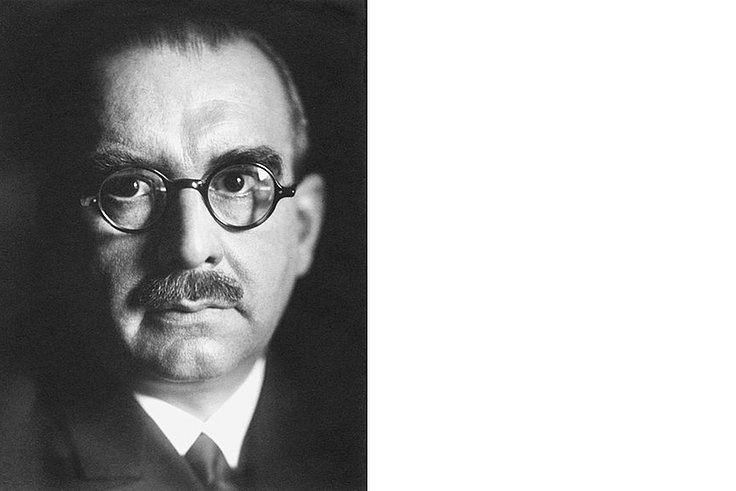
1921 -- 1945
Hermann Wintz (*1887 -- †1947), Entlassung durch die Militärregierung
Ein Wegbereiter der Strahlentherapie
Hermann Wintz wurde am 12. August 1887 als Sohn eines Möbelfabrikanten in Speyer geboren. Medizin studierte er in Heidelberg, Freiburg und Erlangen. Die mittelfränkische Universitätsstadt hat ihn dann nicht mehr losgelassen: Im Anschluss an eine kurze Assistentenzeit in Heidelberg wechselte Wintz zu Ludwig Seitz (1872 -- 1961) an die Erlanger Frauenklinik, habilitierte sich und wurde bereits mit 31 Jahren außerordentlicher Professor. 1921 übertrug man ihm trotz seiner Jugend die Nachfolge von Seitz als Ordinarius und Direktor des "Erlanger Röntgeninstitutes". Wintz leitete die Klinik bis 1945; er starb am 11. Juni 1947.
Die herausragende Lebensleistung von Wintz, der neben seinem medizinischen Doktorgrad auch mit einer Arbeit zur Strahlenphysik promoviert wurde, findet sich auf dem Gebiet der Radiologie. In einem ungewöhnlich erfolgreichen Joint-venture mit der Erlanger Medizintechnik-Firma Reiniger, Gebbert und Schall gelang es ihm, die Frauenklinik ab 1914 für mehrere Dekaden zu einem radiologischen Forschungs- und Behandlungszentrum von internationalem Rang auszubauen. Wesentlich dafür waren seine Untersuchungen mit Seitz zur Röntgentherapie gynäkologischer Krebserkrankungen. Außerdem hatte sich der technisch ungewöhnlich begabte und manuell geschickte Wissenschaftler mit Erfindungen zur Verbesserung der Bestrahlungsgeräte profiliert, die viel Anerkennung und weite Verbreitung fanden.
Wintz genoss nicht nur als Wissenschaftler, sondern auch als Arzt und Mäzen hohes Ansehen. Er zeigte eine häufig bewunderte Großzügigkeit in finanziellen Dingen, mittellose Patientinnen behandelte er oft kostenlos. Sein Einfluss reichte weit über seine klinische und wissenschaftliche Tätigkeit hinaus. Als Rektor der Universität von 1938 bis 1944 versuchte er, den Einfluss der Nationalsozialisten auf die Hochschule zu begrenzen. Dennoch ließ er es zu, dass die Klinik für rassenpolitische Ziele instrumentalisiert wurde. Die Ärzte führten hier wie andernorts in großem Umfang Zwangssterilisationen und Abtreibungen bei Zwangsarbeiterinnen durch. Nach Kriegsende wurde Wintz deshalb seiner Ämter enthoben.
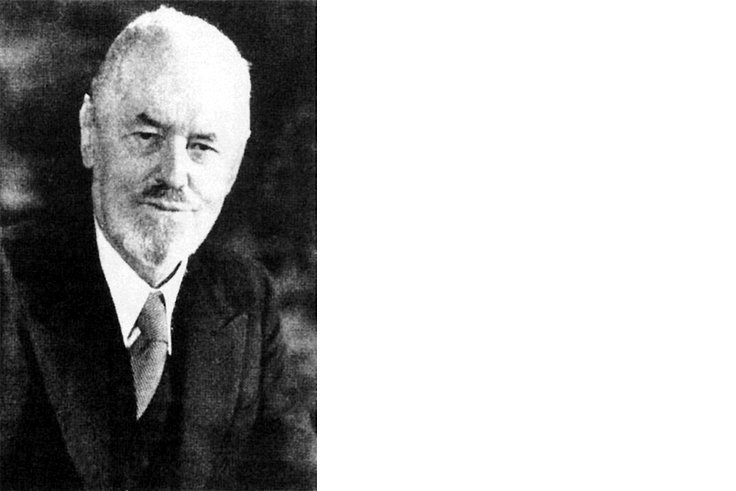
1910 -- 1921
Ludwig Seitz (*1872 -- †1961)
Vater des weltberühmten "Erlanger Röntgeninstituts"
Ludwig Seitz wurde am 24. Mai 1872 in Pfaffenhofen an der Roth geboren. Nach dem Besuch des Gymnasiums studierte er in München, Heidelberg und Berlin Medizin. 1899 trat er als Assistent in die I. Universitäts-Frauenklinik München ein. Seine Lehrer waren hier zunächst Franz v. Winckel (1837 -- 1911) und später Albert Döderlein (1860 -- 1941). Im Jahr 1910 wurde der damals 38-jährige als Ordinarius nach Erlangen berufen, wo er die Klinik elf Jahre lang leitete. In dieser Zeit lehnte Seitz Rufe nach Tübingen, Freiburg und Wien ab. Erst 1921 wechselte er an die Universitäts-Frauenklinik Frankfurt, deren Direktorat er bis zu seiner Emeritierung 1938 innehatte.
Ludwig Seitz hat ein gewaltiges wissenschaftliches Lebenswerk hinterlassen. Er bereicherte fast alle Teilbereiche des Faches mit eigenen Untersuchungen. Als besonders bedeutungsvoll für die Erlanger Frauenklinik erwies sich das Interesse, das er dem Anfang des 20. Jahrhunderts noch weitgehend unerforschten Gebiet der Röntgentherapie von Malignomen entgegenbrachte. Zusammen mit seinem Schüler Hermann Wintz (1887 -- 1947) erarbeitete er bis 1920 vor allem für die Bestrahlung gynäkologischer Krebserkrankungen wichtige Grundlagen. Seitz gilt als Vater des Röntgeninstituts der Frauenklinik, das zwischen den Weltkriegen als Forschungs- und Behandlungszentrum einen internationale Rang einnahm.
Für seine Verdienste um das Fachgebiet wurden Seitz zahlreiche Ehrungen zuteil. So verliehen ihm die Universitäten Erlangen und Frankfurt die Ehrendoktorwürde. Die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie machte Seitz zum Ehrenmitglied und Ehrenpräsidenten, die Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina nahm ihn in ihre Reihen auf. In Frankfurt wurde er außerdem Ehrenbürger der Stadt und Ehrensenator der Universität. In den vergangenen Jahren stellte sich allerdings heraus, dass Seitz in der Frankfurter Universitäts-Frauenklinik wie sein Schüler Wintz in Erlangen während der NS-Herrschaft Zwangssterilisationen und Abtreibungen durchführen ließ. In einer 1998 publizierten Untersuchung wird Seitz außerdem vorgeworfen, er habe sich „in Wort und Schrift nachhaltig für die ‚Rassenhygiene‘ und deren Verwirklichung“ eingesetzt.
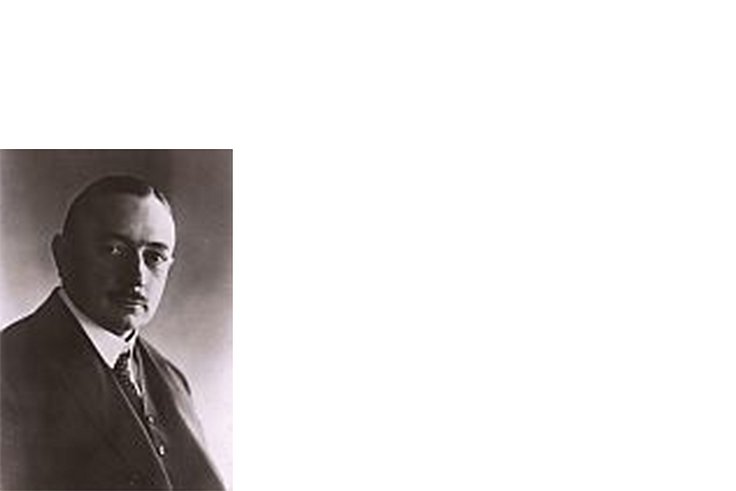
1908 -- 1910
Philipp Jacob Jung (*1870 -- †1918)
Ein kurzes Gastspiel in Erlangen
Philipp Jung wurde am 22. April 1870 in Frankfurt am Main als Sohn eines Oberlandesgerichtrates geboren. Er besuchte das Humanistische Gymnasium in seiner Heimatstadt und studierte ab dem Sommersemester 1889 in Heidelberg, München und Tübingen Medizin. Am 1. März 1894 bestand er in Tübingen das medizinische Staatsexamen, wurde dort als Arzt approbiert und am 1. Oktober 1896 auch promoviert.
Die Fachausbildung begann Jung nach seinem Militärdienst und einem Volontariat im Pathologisch-anatomischen Institut Breslau (polnisch Wrocław) am 1. April 1896 als klinischer Assistent an der chirurgischen Abteilung des dortigen Allerheiligen Hospitals sowie in der Gynäkologie des Elisabeth-Krankenhauses. Am 1. April 1897 trat er als Assistent in die private Frauenklinik des renommierten Berliner Gynäkologen August Martin (1847-1933) ein. Als Martin 1899 einen Ruf an die Universitätsfrauenklinik Greifswald erhielt, folgte Jung seinem Lehrer. Im Jahr 1900 habilitierte er sich, wurde 1901 Oberarzt und 1906 zum a. o. Professor ernannt.
1907 sollte Jung eigentlich das Direktorat der Gynäkologischen Abteilung des städtischen Krankenhauses in seiner Vaterstadt Frankfurt übernehmen. Zugunsten des Rufes an die Universität Erlangen, dem er am 1. April 1908 folgte, trat er die Frankfurter Stelle jedoch nicht an. Die Tätigkeit in der Hugenottenstadt blieb für Jung aber ein berufliches Intermezzo: Als ihm 1910 der besonders traditionsreiche gynäkologische Lehrstuhl an der Universität Göttingen angeboten wurde, konnte er kaum ablehnen. Jung blieb dort bis zu seinem frühen Tod am 28. Juni 1918, der Spätfolge einer Staphylokokken-Infektion war, die er sich bereits im Februar 1917 bei einer Operation zugezogen hatte.
Persönlichkeit und wissenschaftliches Werk des nur 48 Jahre alt gewordenen Hochschullehrers wurden in mehreren emotionalen Nachrufen gewürdigt. Sein Lehrer August Martin hob vor allem seine Verdienste in Greifswald hervor und schrieb: „So wurde Jung, der vornehm denkende, zuverlässige, aufrechte Mann mit vorbildlichem Pflichtgefühl und kollegialer Gesinnung, mir aus dem Gehülfen zum Freund und vollberechtigten Mitarbeiter, der nicht nur von mir empfing, der auch zu geben reichlich die Kraft bewährte [sic!].“
In einem der Nachrufe wird auch ausdrücklich auf die zwei Jahre von Jungs Gastspiel in Erlangen Bezug genommen. Einer seiner damaligen Assistenten, der spätere Professor und Chefarzt am Evangelischen Krankenhaus Düsseldorf, Bernhard Zöppritz, erinnerte sich: „Eine große, teilweise unter seiner Leitung fertiggestellte Klinik, ein gutes, vielseitiges Krankenmaterial, eine große Zuhörerzahl, reichliche der Klinik zur Verfügung stehende Mittel, das waren neben dem ihm zusagenden süddeutschen Leben die Faktoren, die den jungen Ordinarius seine Stellung voll fühlen und genießen ließen.“
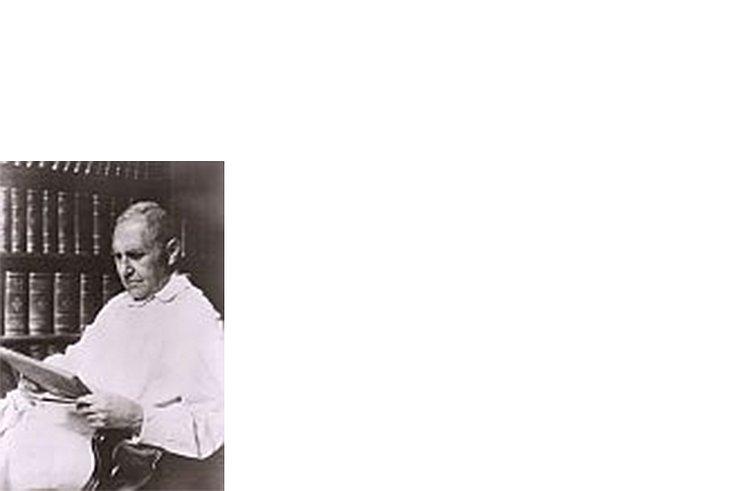
1904 -- 1908
Carl [Karl] Gustav Menge (*1864 -- †1945)
Carl [Karl] Gustav Menge wurde am 18. August 1864 als Sohn eines Kaufmanns in Bad Kreuznach (Rheinland-Pfalz) geboren. Nach dem Abitur in seiner Heimatstadt studierte er von 1884 bis 1889 in München, Freiburg i. Breisgau und Leipzig Medizin. Am 31. Januar 1889 legte er in München das Staatsexamen ab und wurde als Arzt approbiert. Das Jahr des Examens nutzte Menge dann offenbar sehr intensiv zur Fortbildung, u. a. am Hygienisch-Bakteriologischen Institut in Berlin (Robert Koch) und an der Berliner Privatklinik von August Martin (1847-1933), durch dessen Schule viele später sehr erfolgreiche Gynäkologen geprägt wurden. Seine Tätigkeit im Kochschen Institut ermöglichte Menge einen Studienaufenthalt in Oxford, wo er ein bakteriologisches Laboratorium einrichtete.
Ab 1890 war Menge als Hebammenlehrer in Stettin (polnisch Szczecin) tätig, 1892 trat er als Assistent in die Universitätsfrauenklinik Leipzig ein, die von dem früheren Erlanger Ordinarius Paul Zweifel (1848-1927) geleitet wurde. Bei Zweifel habilitierte sich Menge 1897, 1901 wurde er zum a.o. Professor ernannt. Am 1.Oktober 1904 nahm er den Ruf nach Erlangen an und leitete die hiesige Frauenklinik und Hebammenschule, bis er 1908 nach Heidelberg wechselte. Am 1. Oktober 1930 wurde Menge dort emeritiert. Er starb am 9. Oktober 1945 an seinem Altersruhesitz München.
Als Menge 1904 das Erlanger Ordinariat übernahm, hatte er sich schon durch zahlreiche Publikationen wissenschaftlich profiliert. Ein Schwerpunkt lag wie auch in den späteren Jahren seiner Tätigkeit vor allem auf der damals noch neuen Bakteriologie, die er mit Blick auf gynäkologisch-geburtshilfliche Fragestellungen untersuchte. Der Ausbildung bei Martin und Zweifel verdankte Menge aber auch Fähigkeiten, die ihm Beiträge zu operativen Aspekten des Faches ermöglichten (inguinale Tubensterilisation, abdominale Radikaloperation bei Uteruskarzinom, Myomenukleation, suprasymphysärer Faszienquerschnitt). Frühzeitig wandte er sich zusätzlich der aufstrebenden Radiologie zu. Die Erlanger Frauenklinik verdankte seiner Initiative 1905 ihr erstes Röntgengerät.
Während seiner nur vierjährigen Amtszeit in der Hugenottenstadt dürfte Menge neben seiner Tätigkeit als Arzt und Hochschullehrer vor allem mit dem Ausbau der Klinik beschäftigt gewesen sein, die trotz eines im Herbst 1902 eingeweihten Erweiterungsbaues (Frommel-Geßner-Bau) wieder unter akuter Raumnot litt. Nach vielen Bemühungen konnte Menge 1905 den großen Erweiterungsbau durchsetzen, der sich noch heute im Norden des Geländes von West nach Ost erstreckt (Menge-Bau). Zusammen mit dem Frommel-Geßner-Bau und dem bereits 1876-1878 errichteten Schröder-Zweifel-Bau formte das Gebäude bis zur Einweihung des Geburtshilfe-Neubaus im Osten (2005) rund ein Jahrhundert lang den Klinikgrundriss.
Menge zählte bis in die 1930er Jahre zweifellos zu den einflussreichsten deutschen Gynäkologen. 1922 wählte ihn die seinerzeitige Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie (DGG) zu ihrem Präsidenten, 1923 leitete er in Heidelberg den Kongress der Fachgesellschaft, die ihn im Jahr nach seiner Emeritierung zu ihrem Ehrenmitglied ernannte. Bei der ersten Nachkriegstagung der DGG 1949 erinnerte der damalige Präsident Rudolf von Jaschke an Menges „grundlegende Untersuchungen zur Bakteriologie des weiblichen Genitalkanales“, seinen „kühnen Vorstoß gegen die operative Behandlung der weiblichen Genital-Tbc“ und seinen „Kampf um [sic] die kritiklose Anwendung der Zangenoperation“. Keine Erwähnung fand, dass sich Menge nach seiner Emeritierung in der DGG offenbar sehr unbeliebt gemacht hatte. Man warf ihm vor, nach 1933 im Nationalsozialismus Schüler von sich mit Hilfe der Politik in Ordinariate gehoben zu haben. Man solle „ihn für seine Schiebung nicht noch belohnen“, hieß es 1935 bei einer Vorstandsbesprechung in engerem Kreis, bei dem Kandidaten für den „Ehrenpreis der DGG“ diskutiert wurden.
1903 -- 1904
Johann Friedrich Otto Veit (*1852 -- †1917)
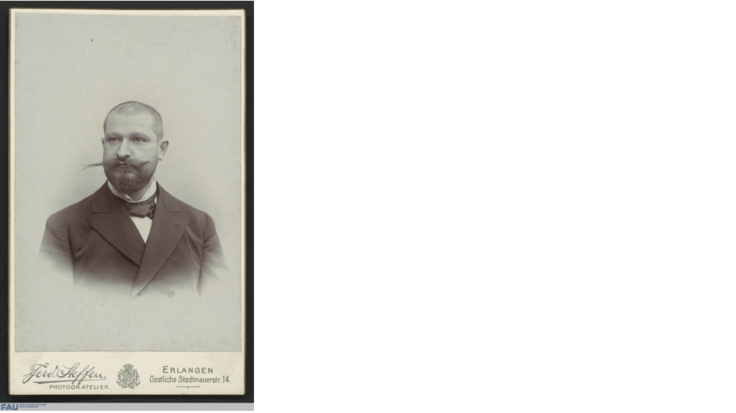
1901 -- 1903
Adolf Geßner (*1864 -- †1903)
Tragisches Ende einer vielversprechenden Karriere
Adolf Gessner wurde am 4. Februar 1864 als Sohn eines Großherzoglich Hessischen Baurates in Friedberg (Oberhessen) geboren. Er besuchte das Gymnasium in Darmstadt und studierte ab 1883 in Gießen und Erlangen Medizin. Nach der Promotion mit einer Arbeit zu „Mikroskopischen Untersuchungen über den Bakteriengehalt der menschlichen Haut“ (März 1889) legte er am 1. März 1890 dort auch das Staatsexamen ab und wurde am 2. April des Jahres approbiert.
Die berufliche Laufbahn Gessners begann im März 1890 mit einer Tätigkeit als klinischer Assistent an der Wasserheilanstalt in Michelstadt (Hessen). Im November 1890 wechselte er als wissenschaftlicher Assistent an die Erlanger Frauenklinik, die damals von Richard Frommel (1854-1912) geleitet wurde. Als Frommel in Gessner großes wissenschaftliches Potential erkannte, riet er ihm 1893 zu einem zeitweisen Wechsel an die I. Universitätsfrauenklinik Berlin. Dort war Gessner bis 1897 Schüler von Robert von Olshausen (1835-1915) und Carl Ruge (1846-1926). Olshausen gilt als einer der Wegbereiter der operativen Gynäkologie, Ruge als Begründer der Gynäkopathologie. Nach seiner Rückkehr wurde Gessner 1897 habilitiert und im Jahr darauf zum Lehrer an der Hebammenschule ernannt. Als Frommel 1901 völlig überraschend im Alter von erst 47 Jahren von seinen Ämtern als Direktor der Klinik und der Hebammenschule zurücktrat, berief man Gessner zu seinem Nachfolger.
Mit Gessner hatte die Frauenklinik nach dessen Habilitation 1897 erstmals in ihrer Geschichte neben dem Ordinarius einen zweiten Dozenten erhalten. Zusammen mit Frommel projektierte er neben dem zu klein gewordenen Schröder-Zweifel-Bau einen Neubau, der 1900 genehmigt und im Jahr nach dem Rückzug Frommels eingeweiht wurde (Frommel-Gessner-Bau). Von den so verbesserten Rahmenbedingungen für Forschung, Lehre und die Versorgung der zunehmenden Zahl von Patientinnen konnte der mit viel Engagement ans Werk gegangene neue Klinikchef allerdings nicht lange profitieren: Unter dem Eindruck drohenden Siechtums durch eine unheilbare Krankheit, deren Symptome er an sich festgestellt zu haben glaubte, beging Gessner am 24. Januar 1903 Suizid.
Über die näheren Umstände des Ablebens des offenbar außerordentlich beliebten Arztes und Hochschullehrers wurde in Erlangen ein Mantel des Schweigens gelegt. In Nachrufen finden sich nur Andeutungen zu seinem – wie es in einem davon heißt – „jähen Tod, dessen Kunde mit erschütternder Wucht alle traf, die ihm beruflich und gesellschaftlich nahe standen.“ Hier wird auch die besondere Begabung Gessners hervorgehoben, alles „was er jemals gelesen oder gehört“ in seinem Gedächtnis „in allen Einzelheiten und für alle Zeiten“ festgehalten zu haben.
Bildquelle: UB Erlangen-Nürnberg, Portr. Repr. 16° Gessner, Adolf <1>
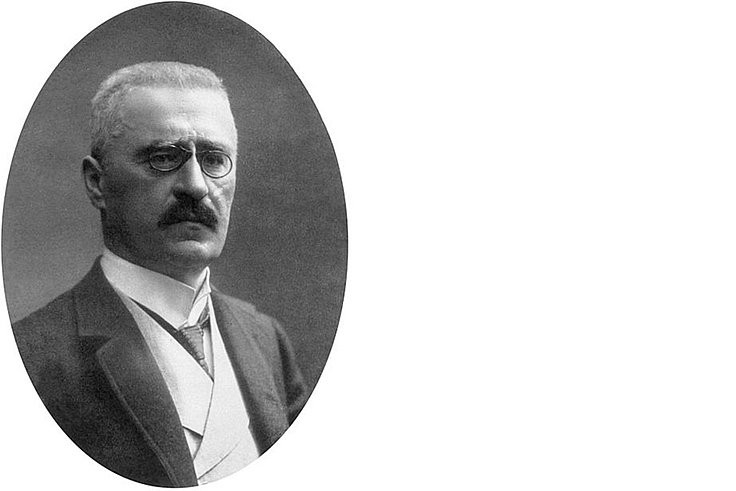
1887 -- 1901
Richard Frommel (*1854 -- †1912)
Pionier bei der Behandlung der rupturierten Extrauteringravidität
Richard Frommel wurde am 16. Juli 1854 in Augsburg geboren. Er studierte in München, Göttingen und Würzburg. Zu seinen akademischen Lehrern gehörte der berühmte Frauenarzt Karl Schröder (1838 -- 1887), der von 1869 bis 1876 in Erlangen Ordinarius gewesen war. Bei Schröder an der I. Universitäts-Frauenklinik Berlin arbeitete Frommel von 1879 bis 1882 zunächst als Assistent, dann als Oberarzt. Anschließend ging er nach München, habilitierte sich dort und leitete eine "Privatanstalt für Frauenkrankheiten". 1887 erhielt Frommel den Ruf nach Erlangen. Im Jahr 1901 trat er im Alter von erst 46 Jahren nach knapp 13-jähriger Tätigkeit als Direktor der Erlanger Frauenklinik aus unbekannten Gründen überraschend von allen Ämtern zurück, ging wieder nach München und gab jede ärztliche Tätigkeit auf. Frommel starb am 6. April 1912 an den Folgen einer akuten Appendizitis.
Während seiner Erlanger Zeit publizierte Frommel über 30 Arbeiten, die sich mit allen Teilbereichen des Fachgebietes befassten. 1887 begründete er "Frommels Jahresberichte für die Geburtshilfe und Gynäkologie", die erste Referate-Sammlung über alle wichtigen Publikationen des Fachgebietes. Die Geburtshilfe und studentische Ausbildung lagen ihm besonders am Herzen. Unter seiner Ägide wurde eine wesentliche bauliche Erweiterung der Klinik auf den Weg gebracht: Es handelt sich um den Westflügel, der 1902 von seinem Nachfolger Adolf Gessner (1864 -- 1903) eingeweiht werden konnte.
Die Frauenheilkunde verdankt Frommel unter anderem einen entscheidenden Impuls zum Umdenken bei der Therapie der rupturierten Extrauterinschwangerschaft. Im Gegensatz zu der damals geltenden Lehrmeinung, die abwartendes Verhalten empfahl, setzte sich Frommel für die sofortige operative Intervention ein. Sein Name ist außerdem noch heute in dem Eponym "Chiari-Frommel-Syndrom" gegenwärtig, das die persistierende Galaktorrhö-Amenorrhöe post partum bezeichnet.
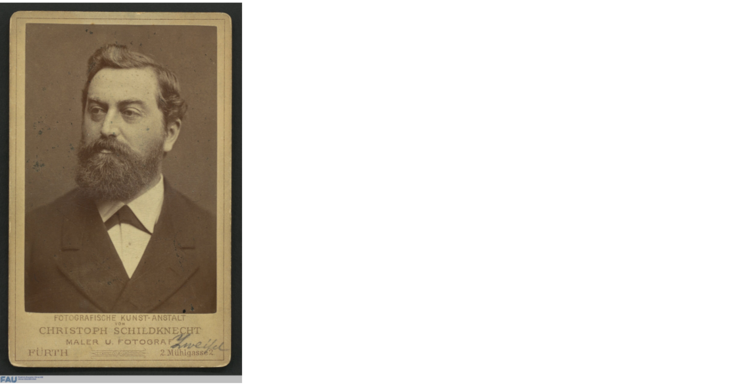
1876 -- 1887
Paul Zweifel (*1848 -- †1927)
Pionier in der Erforschung der fetalen Physiologie
Paul Zweifel wurde am 30. Juni 1848 in Höngg bei Zürich als Sohn eines praktischen Arztes geboren. Er ging in Zürich zur Schule und studierte dort auch Medizin. 1872 trat Zweifel als Assistent des Geburtshelfers Adolf Gusserow (1836 -- 1906) in die Züricher Frauenklinik ein und wurde mit einer Dissertation über Adnexeingriffe promoviert. Wenig später begleitete er seinen Lehrer an die neugegründete Universität Straßburg und habilitierte sich 1874. Bereits zwei Jahre später wurde Zweifel im Alter von erst 28 Jahren zum Direktor der Erlanger Frauenklinik berufen. 1887 trat er dann die Nachfolge von Carl Credé (1819 -- 1892) in Leipzig an. Dort wirkte Zweifel bis zu seiner Emeritierung 35 Jahre lang. Er starb am 13. August 1927 im Alter von 79 Jahren.
Das wissenschaftliche Werk Zweifels, der geburtshilfliche Probleme ebenso umfassend bearbeitete wie Fragen der operativen Gynäkologie, fand in 160 Publikationen seinen Niederschlag. Er gehörte zu den ersten Gynäkologen, die physiologisch-chemische Aspekte ihres Fachgebietes untersuchten. Als Zweifel seine Tätigkeit in Erlangen aufnahm, war er wegen seiner zuvor im Straßburger Institut von Felix Hoppe-Seyler durchgeführten Arbeiten zur Physiologie des Feten und der Plazenta bereits ein berühmter Mann. Er hatte dabei unter anderem im Tierexperiment zeigen können, dass Feten in utero stoffwechselaktiv sind und Sauerstoff verbrauchen. Diese Frage war bis zu Zweifels Untersuchungen heftig umstritten. Seine entsprechende Publikation, die 1876 unter dem Titel „Die Respiration des Fötus“ im „Archiv für Gynäkologie“ erschien, wird als Beginn der modernen Forschung auf dem Gebiet der fetalen Physiologie betrachtet.
Die bei Hoppe-Seyler erlernten Techniken und Betrachtungsweisen der experimentellen Physiologie haben Zweifel entscheidend geprägt. Als er in Erlangen vor der Notwendigkeit stand, sich als Autodidakt mit der eben beginnenden gynäkologischen Chirurgie auseinander zu setzen, bestimmten sie sein Denken und Handeln. So lehnte er beispielsweise verstümmelnde Eingriffe wie die Operation nach Porro als unphysiologisch ab. Zum klassischen Kaiserschnitt konnte er sich erst entschließen, als ihm die Datenlage ausreichende Sicherheit versprach. Zu Beginn seiner Erlanger Tätigkeit setzte Zweifel die Pläne seines Vorgängers Karl Schroeder (1838 -- 1887) für einen Neubau der Klinik in die Tat um. So entstand in den Jahren bis 1878 der Südflügel an der Universitätsstraße als erster Teil des heutigen Gebäudekomplexes (Schröder-Zweifel-Bau).
Bildquelle: UB Erlangen-Nürnberg, Portr. Repr. 16° Zweifel, Paul <1>
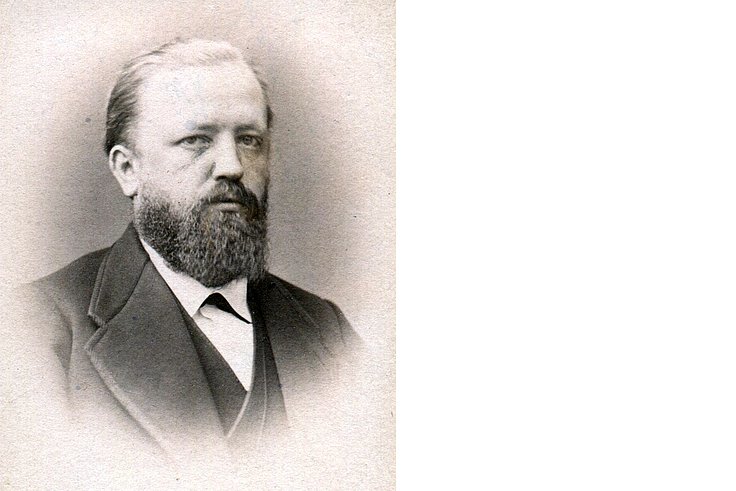
1868 -- 1876
Karl Ludwig Ernst Friedrich Schröder (*1838 -- †1887)
Aus dem Gebärhaus wird die Frauenklinik
Karl Ludwig Ernst Friedrich Schröder wurde am 11. September 1838 in Neustrelitz geboren. Nach dem Besuch des Humanistischen Gymnasiums in seiner Heimatstadt studiert er in Würzburg und Rostock Medizin. Im Anschluss an eine kurze Assistentenzeit in der Medizinischen Klinik Rostock wollte sich Schroeder eigentlich als Landarzt niederlassen, folgte dann jedoch "nach kurzem Zaudern" einer Aufforderung des Rostocker Geburtshelfers Gustav Veit (1824 -- 1903), mit ihm an die Universität Bonn zu gehen. Veit hatte 1864 einen Ruf dorthin erhalten. Mit dem Wechsel begann Schröders steile Karriere: 1866 Habilitation, 1869 Ordinarius in Erlangen und 1876 Ruf an die I. Universitäts-Frauenklinik Berlin, die er bis zu seinem plötzlichen Tod am 7. Februar 1887 leitete.
Karl Schröder gehört zweifellos zu den bedeutendsten deutschen Frauenärzten des vergangenen Jahrhunderts. Seine wissenschaftlichen Arbeiten beschäftigten sich mit fast allen Bereichen der Geburtshilfe und Gynäkologie. Als anerkannt geschickter und einfallsreicher Operateur war Schröder der erste unter den Vertretern der "Berliner Schule", die der operativen Gynäkologie wesentliche Impulse gegeben haben. Dabei begünstigten die äußeren Umstände sein Wirken: Mit Einführung der Antisepsis in den siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts nahmen die grundsätzlichen Risiken operativer Eingriffe ab und die großen Patientenzahlen der Berliner Klinik ermöglichten besonders aussagekräftige Untersuchungen. Zu den Mitarbeitern Schröders gehörte Carl Ruge (1846 -- 1926), der in mehr als 30-jähriger Tätigkeit die Grundlagen der gynäkologischen Histopathologie erarbeitete und frühzeitig erkannte, dass die mikroskopische Diagnostik an kleinen Exzidaten (z. B. Abradat, Zervix-Probeexzision) den Weg zur Frühdiagnose der Uteruskarzinome eröffnen konnte.
Schröder war der erste unter den Erlanger Geburtshelfern, der sich für das Fach auch habilitiert hatte. In seiner Amtszeit vollzog sich 1870 mit der Einrichtung von vier Betten für gynäkologische Patientinnen der Wandel der Klinik von einer rein geburtshilflichen Einrichtung zur Frauenklinik. Schröder initiierte ferner einen Klinikneubau und etablierte 1874 gegen viele Widerstände die 4. Bayerische Hebammenschule an der Frauenklinik. Zwei Lehrbücher Schröders zur Gynäkologie und Geburtshilfe, die in Erlangen entstanden, wurden zu großen Erfolgen mit hohen Auflagenzahlen und sicherten ihm schließlich den Ruf nach Berlin.
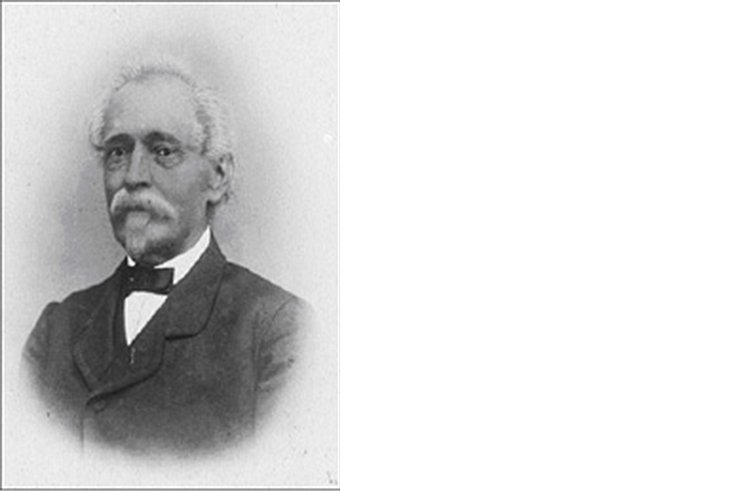
1833 -- 1868
Johann Eugen Rosshirt (*1795 -- †1872)
Erste Vorlesungen über "Frauenzimmerkrankheiten“
Johann Eugen Rosshirt wurde am 11. November 1795 in Oberscheinfeld (Mittelfranken) geboren. Über seine Ausbildung ließen sich nur spärliche Angaben finden. Wir wissen aber, dass er in Würzburg Medizin studierte und aus der geburtshilflichen Schule von Josef Servatius v. d'Outrepont (1775 -- 1845) stammt, der 1816 als Ordinarius von München nach Würzburg berufen worden war. Rosshirt arbeitete zunächst als Hebammenlehrer und Prosektor der Chirurgenschule in Bamberg. 1833 wurde er dann als Nachfolger des Chirurgen Michael Jäger zum ordentlichen Professor und Direktor der Geburtshilflichen Klinik Erlangen ernannt, die damals noch in einem Gebäude an der Nürnberger Straße untergebracht war. Er leitete die Klinik bis 1868 und starb am 13. Juli 1872.
Von Zeitgenossen wird Rosshirt als sehr geschickter Geburtshelfer beschrieben. Bis zu seinem Rückzug aus der praktischen Tätigkeit 1868 wurden in der Klinik rund 2000 Frauen stationär behandelt. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern bereicherte Rosshirt das Fach auch durch Veröffentlichungen: aus seiner Feder stammen mehrere Lehrbücher. Diese Schriften dürfen als Ausdruck einer besonderen Neigung für die Lehre gewertet werden. Rosshirt ließ es sich deshalb trotz schlechten Gesundheitszustandes bis zu seinem Tod im Sommer 1872 nicht nehmen, die Vorlesungen selbst zu halten, obwohl ihm sein Nachfolger Karl Schroeder (1838 -- 1887) bereits 1868 zu Seite gestellt worden war.
Rosshirt hat sich große Verdienste um die Entwicklung der Erlanger Frauenheilkunde erworben. Bereits in einem der ersten Semester nach seiner Berufung begann er, auch über "Frauenzimmerkrankheiten" Vorlesungen zu halten. Damit wurde die Gynäkologie theoretisch etabliert. Diese Entwicklung setzte Schröder dann mit der Einrichtung der ersten gynäkologischen Betten praktisch fort. Darüber hinaus erkämpfte Rosshirt gegen viele Widerstände, dass das Gebärhaus in der Nürnberger Straße durch einen Neubau ersetzt wurde. Das Gebäude entstand 1854 in unmittelbarer Nähe des Universitätskrankenhauses auf dem Gelände der heutigen Pathologie (Rosshirt'scher Bau) und kann nach der Einrichtung der gynäkologischen Betten durch Schröder als erste echte Frauenklinik Erlangens bezeichnet werden.
1826 -- 1832
Philipp Anton Bayer (*1791 -- †1832)
Begründer der klinischen Geburtshilfe in Erlangen
Philipp Anton Bayer, am 19. Dezember 1791 als Sohn eines Holzhändlers in Bamberg geboren, ist der Begründer der klinischen Geburtshilfe in Erlangen. Er studierte vom Wintersemester 1810 an in der Hugenottenstadt Medizin und wurde am 3. Oktober 1814 zum Dr. med. promoviert. Seine Dissertation hatte er entgegen der damals noch weitgehend üblichen Praxis in Deutsch statt in Latein verfasst. Sie trug den Titel „Über Trichiasis und Entropium, nebst Beschreibung einer verbesserten Augenlidzange“. Ab 1815 war er zunächst als praktischer Arzt in Erlangen und als Augenarzt in Nürnberg niedergelassen.
Schon während seines Studiums hatte Bayer als Gehilfe am Institutum clinicum der Universität gearbeitet. Nach dem Examen war er in dieser Funktion auch am dortigen Institutum chirurgicum tätig, der Keimzelle des Universitätsklinikums. Dessen Gründer und Leiter Bernhard Schreger (1766-1825) hatte damals neben der Chirurgie und der Arzneimittelkunde vertretungsweise auch die Professur für Entbindungskunst inne. 1822 wurde Bayer bei Schreger wissenschaftlicher Assistent. Nach Schregers Tod im Oktober 1825 und zunächst erfolglosen Bemühungen, die Chirurgie und die Geburtshilfe von extern neu zu besetzen, berief die Fakultät Bayer am 2. November 1826 schließlich zum außerordentlichen Professor für Entbindungskunst.
Bereits einen Monat nach seiner Berufung begann Bayer, sich um die Einrichtung einer Entbindungsanstalt zu bemühen. In mehreren Anträgen an die Fakultät wies er darauf hin, dass die damals von den Studenten vehement eingeforderte praktische geburtshilfliche Ausbildung ohne klinische Einrichtung nur sehr ungenügend realisierbar war. Im August 1827 wurde das Projekt schließlich von der Regierung genehmigt. So konnte Bayer am 30. März 1828 in einem umgebauten Wohnhaus an der damaligen Peripherie der Stadt die offizielle Eröffnung der „Entbindungsanstalt der Königl. Universität Erlangen“ verkünden.
Bayer und die Entbindungsanstalt waren und blieben allerdings bis zum frühen Tod des Geburtshelfers am 11. Juni 1832 ungeliebte Kinder der Fakultät. Vor seiner eher der Not gehorchenden Berufung hatte sie mehrere Anträge Bayers auf eine Professur abgelehnt. Begründet wurde dies jeweils mit Zweifeln an seiner wissenschaftlichen Befähigung und nicht ausreichender klassischer Bildung. Selbst in seiner Funktion als Direktor des Gebärhauses verweigerte man ihm die ordentliche Professur, obwohl er sich mit viel Erfolg für die werdenden Mütter und den geburtshilflichen Unterricht engagierte. Allerdings blieb die Entbindungsanstalt stets defizitär – ein Umstand, der angesichts der überwiegend mittellosen Klientel nicht überrascht, aber in der Fakultät immer wieder für Missstimmung sorgte.
1805 -- 1825
Bernhard Nathanael Gottlob Schreger (*1797 -- †1825)
1796 -- 1805
Christian Friedrich (von) Deutsch (*1768 -- †1843)





